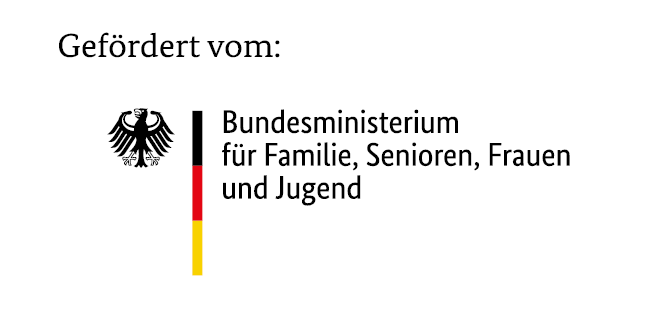Schulsozialarbeit im digitalen Kontext
Junge Menschen begleiten, unterstützen, befähigen
Materialien der Fachtagung vom 07. – 08. Dezember 2021
Die Digitalisierung prägt den Alltag junger Menschen und verändert ihre Kommunikations- und Bildungsprozesse grundlegend. Doch welche Auswirkungen hat dies auf die Schulsozialarbeit? Wie können Fachkräfte junge Menschen dabei begleiten, digitale Kompetenzen zu entwickeln, soziale Netzwerke reflektiert zu nutzen und sich sicher im digitalen Raum zu bewegen?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Nikolaustagung 2021, die ursprünglich als Präsenzveranstaltung in Eisenach geplant war, jedoch pandemiebedingt online durchgeführt wurde. Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis diskutierten, welche Herausforderungen und Chancen die digitale Transformation für die Schulsozialarbeit mit sich bringt.